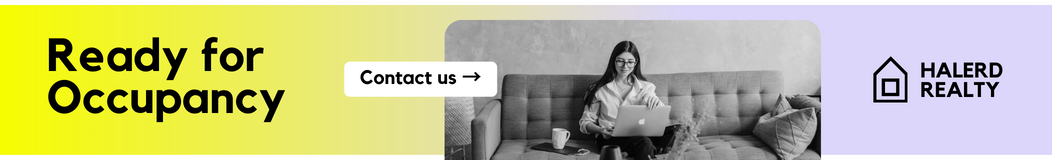Abgesänge auf sogenanntes Craft Beer gab es in letzter Zeit einige. Aber ist der Kampf um besondere Biere in Deutschland wirklich verloren beziehungsweise Kreativbier in einer Nische verschwunden, aus der es nicht mehr rauskommt und an Bedeutung verliert? Eine Spurensuche in Berlin.

Ein neuer Brauer kommt in die Stadt, bringt eine Idee mit, plötzlich, so scheint es, sind alte Gewissheiten von gestern und das Bier, das eben noch gut verkauft wurde, ebenfalls. Der Ort, an dem Thorsten Schoppe arbeitet, erinnert ihn manchmal daran. Seine Brauerei liegt auf dem Pfefferberg. Das ist ein kleines Areal an der Schönhauser Allee am Prenzlauer Berg in Berlin. „Pfefferberg, weil Herr Pfeffer, ein Braumeister aus Bayern, mit einer Tasche untergäriger Hefe nach Berlin gekommen ist und hier eine Brauerei eröffnet hat“, erklärt Thorsten Schoppe. 1841 hat Joseph Pfefferberg die ersten untergärigen Biere im Kiez gebraut, die alteingesessenen Brauer damit mächtig unter Druck gesetzt. Nach einigen Besitzerwechseln wurde Pfeffers Brauerei nach dem Ersten Weltkrieg vom Platzhirsch Schultheiss gekauft und kurz darauf dichtgemacht.
Thorsten Schoppe braut seit 2001 sein eigenes Bier. Aus heutiger Sicht ist er einer der deutschen Craft-Brewer der ersten Stunde. Als er angefangen hat, nannte das nur noch niemand so. Und inzwischen sei das mit dem sogenannten Craft Beer auch nicht mehr so wichtig. „Der große Hype ist vorbei“, sagt Schoppe. Wenn er sich richtig entsinne, dann sei das in Berlin 2011 losgegangen. „Da gab es plötzlich Bottleshops und das erste Pale Ale“, erinnert er sich. „Da haben sich viele drangehängt, wir hatten wilde Pläne – aufgegangen sind sie nicht. Zum Glück keine größere Brauerei gebaut, die nicht ausgelastet wäre“, sagt er.

(Foto: Martin Rolshausen)
Etwa 90 Prozent des Biers, das er braut, wird in Flaschen verkauft – bei Rewe, bei Edeka, von einem großen Berliner Getränkehändler, von Online-Lieferanten. Vor allem seine Bio-Biere seien da gefragt. Bio und lokal, das funktioniere ganz gut. „Regionalität ist ein Faktor“, sagt Schoppe. „In die normale Gastro kommen wir mit unserm Bier nicht rein. Wir sind teuer und machen keine Finanzierung“, erklärt er. Keine Finanzierung bedeutet: Anders als die großen Konzerne kann Schoppe den Gaststätten keine Zapfanlagen und Inneneinrichtungen hinstellen.
„Aktuell ist das Konsumklima etwas doof. Die Leute trinken kein teures Bier, wenn sie nicht wissen, ob sie die Stromrechnung bezahlen können. Corona, Krieg, kein Malz, weil die halbe Mälzerei in Quarantäne ist – wir hoffen, dass es aufhört, so lange müssen wir die Pobacken zusammenkneifen“, beschreibt Schoppe das, was alle Brauer umtreibt. Das Interesse am sogenannten Craft Beer habe allerdings schon vor diesen Krisen abgenommen.
„Es gab schon vor der Pandemie etwas Ernüchterung“, sagt auch Katharina Kurz, die Mitgründerin von BRLO. Sie ist mit ihrem Team 2014, in der Boomphase, in die Branche eingestiegen. „Wir kamen Ende 2014 mit den ersten Bieren raus. Da war gute Stimmung, da jagte ein Bierfestival das andere“, erinnert sie sich. Diese Zeiten sind vorbei – und viele Hoffnungen gestorben. „In Berlin finden Wirte lokales Bier gut, nehmen aber nur ein Flaschenbier dazu“, sagt Kurz. Mehr als drei Hähne gebe es selten. Aus einem fließe meistens Pils, aus dem anderen Helles. Wenn man es schaffe als Craft Brewer den dritten Hahn zu bekommen, dann werde das groß gefeiert. Von Zuständen wie in der USA, wo in Kneipen aus einer ganzen Reihe von Hähnen Biere vieler Brauereien parallel fließen, könne man in Deutschland weiter nur träumen. „Diese Hoffnung, dass die Gastronomie so wie sie 20 Weine auf der Karte hat, auch 20 Biere anbietet, hat sich nicht erfüllt“, sagt Katharina Kurz.

(Foto: Martin Rolshausen)
Dass Craft Beer in Deutschland keinen relevanten Marktanteil hat, liege auch daran, „dass ihm der Handel früh, viel zu früh und viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt“ habe. Der Konsument sei „noch nicht so weit gewesen“. Auch die Qualität einiger Biere sei noch nicht ganz ausgereift gewesen. Und wenn dann ein Kunde aus Unwissen als erstes ein Double-IPA erwischt hat, dann sei ganz schnell die Frage gestellt worden: „Das soll also das neue Bier sein?“
Das alles sei ernüchternd, „aber ich glaube nach wie vor an die Biervielfalt“, sagt Kurz. Sie rät zu „langsamem und solidem Arbeiten“. Es habe auch beim Wein etwas gedauert, bis sich die Vielfalt etabliert hat. Früher gab es in vielen Restaurants und Kneipen auch nur einen Weißen und einen Roten. Wein eben. So sei das heute für viele Deutsche auch noch beim Bier. Bier sei etwas Gutes, aber eben nur Bier. „Die Winzer haben es geschafft, Geschichten zu erzählen, uns ist das noch nicht so richtig gelungen“, vermutet Kurz. Es dauere „einfach länger“, als man vor zehn Jahren gehofft habe.
Man dürfe nicht den „Riesenfehler“ machen, „die Leute zu überfordern“, sagt die BRLO-Frau. Und „Wir dürfen nicht arrogant sein.“ Als BRLO mit einem Pale Ale und einem Lager angefangen hat, haben einige aus der Szene die Nase gerümpft, erinnert sich Kurz. „Wir mussten uns am Anfang rechtfertigen: ,Helles ist doch kein Craft Beer‘, hieß es.“ Inzwischen sei klar: Wer überleben will, muss auch leichter trinkbare Biere im Sortiment haben.
Ein weiteres deutsches Problem: Craft Beer ist hierzulande noch teurer als Industriebier als etwa in den USA und England, weil Bier in Deutschland generell billiger ist als in vielen anderen Ländern. Dazu komme, dass Brauereien in anderen Ländern weniger mit steigenden Preisen für Glas, Energie und Malz zu kämpfen haben. „Die Krise nach der Krise nach der Krise“ treffe also nicht nur die Gastronomie hart, sondern auch die Brauereien. Für BRLO werde 2023 deshalb „ein Jahr der Fokussierung“, das heißt, dass es „weniger Specials“ geben werde, kündigt Katharina Kurz an.
Oliver Lemke sieht vieles ähnlich. Dass Bier als billiges Getränk wahrgenommen wird und es handwerkliche Brauer daher schwer haben, zum Beispiel. Dass handwerklich gebrautes und damit etwas teureres Bier mehr nachgefragt wird, ist auch aus seiner Sicht „eine Frage der Zeit“. „Die Geschwindigkeit war zu hoch“, glaubt auch er.

(Foto: Martin Rolshausen)
Oli Lemke braut seit 1999 mitten in Berlin in der Nähe des Alexanderplatzes. „Wir waren ja eigentlich die Revolution als wir mit einer Low-Budget-Anlage begonnen haben. Das war das, was 15 Jahre später Craft hieß“, sagt er. „15 Jahre lang hat es keine Sau interessiert, was wir hier machen. Am Anfang haben wir die Vielfalt rausgenommen, weil sie niemand haben wollte, dann haben wir sie wieder reingenommen“, erinnert er sich. Dann haben plötzlich alle von Craft Beer geredet, die Journalisten kamen.
Der Boom sei allerdings nicht nur ein Segen gewesen. „Die mussten alle tätowiert sein und im Prenzelberg wohnen“, erinnert er sich und sagt: „Craft wurde als Marke der Hipster, der politisch Korrekten wahrgenommen. Dieses Image hat uns geschadet. Unser Anspruch war immer: Bier für alle machen.“ Es sei für ihn immer nur ums eins gegangenen: „Wir machen einfach geiles Bier.“ Das habe er ohne Investor geschafft. Zwei Drittel seines Biers verkauft er in seinen eigenen Kneipen. Das habe die Lage während der Pandemie für ihn besonders schwer gemacht. Ja, auch seine Brauerei kämpft mit den gestiegenen Preisen für Rohstoffe und Energie. „Aber was jetzt passiert ist ein Witz gegen Covid“, sagt Lemke. Er bleibt zuversichtlich. „Wir kriegen das hin“, versichert er.

(Foto: Martin Rolshausen)
Aber, dass Craft Beer schnell zu einer Erfolgsgeschichte wird, glaubt er nicht. Das habe er schon nicht geglaubt, als ihm Garrett Oliver von der Brooklyn Brewery und Greg Koch von Stone erklärt haben, dass Craft Beer auch in Deutschland boomen wird. „Ich habe nicht erwartet, dass das explodiert hier – nicht in Berlin“, sagt Lemke. So wenig, wie er sich damals von der „überhitzten Erwartung“ hat mitreißen lassen, so wenig Grund sieht er jetzt gerade für ernsthafte Beunruhigung. Es sei recht einfach: „Wir haben immer unser Ding gemacht und werden weiter unser Ding machen – das ist cool.“
Was ihn aber ärgert sind Kollegen, die Preisschlachten anzetteln. Brauereien, „die Verluste machen, um Marktanteile zu gewinnen – das ist das, was mich am ehesten stört“.
Thorsten Schoppe übt sich ebenfalls in Gelassenheit: „Irgendwie geht es immer weiter. Ich war vor dem Craft-Beer-Boom da und werde auch danach noch da sein“, sagt er. Und: „Als Greg Koch hier ankam, war das schon eine coole Zeit. Plötzlich bist du in einer Boombranche. Aber plötzlich ist wieder alles anders. Da verbietet dir plötzlich jemand, deine Kneipe aufzusperren. Damit hat niemand gerechnet. Aber man muss flexibel sein.“ Greg Kochs Berliner Hoffnung ist gestorben wie viele andere Träume in der Branche auch. 2016 hat er seine Brauerei mit Restaurant und Biergarten eröffnet, drei Jahre später an Brewdog verkauft. Greg Koch hat viel bewirkt mit seiner kompromisslosen Art, vor allem in den USA, war in Berlin aber auch nur einer der neuen Brauer, die irgendwann in die Stadt kamen, eine neue Idee mitbrachten und es plötzlich so schien, als seien die alten Gewissheiten von gestern.