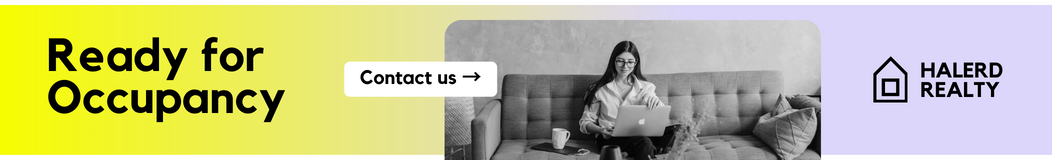Im Craft Beer Regal erkennt man die To Øl Flaschen zuverlässig daran, dass man sie nicht gleich erkennt. Kein Label sieht aus wie das andere, es gibt kein einheitliches Design, kein durchgestyltes CI. Und genau das ist Methode, erklärt Tobias Emil Jensen, einer der beiden Gründer, in einem Interview über Konsistenz, wilde Bierideen und den deutschen Craft Beer Markt

Traurige Wahrheit zum Ende der Sommerferien: Der größte Teil von dem ganzen Mist, den man in der Schule so lernt, braucht man später im echten Leben nie wieder. Latein, Stochastik, Die Glocke – für die Katz. Tore Gynther und Tobias Emil Jensen hingegen haben etwas sehr praktisches in der Schule gelernt: Bier brauen. Die beiden waren zusammen im Bier-Brau-Club ihrer Schule (ja, so etwas gibt es, sei in Dänemark sogar ziemlich üblich, sagt Tobias) und hatten dabei den allerbesten Lehrer, nämlich Mikkel Borg Bjergsø, den Mikkel Borg Bjergsø, der 2006 seinen Job als Lehrer kündigte, um mit Mikkeller eine der berühmt-berüchtigsten Craft Beer Brauereien der Welt zu gründen. Ein Brauernaturtalent und Beerfreak mit größter Leidenschaft.
In den Braustunden mit Bjergsø entdeckten Tobias und Tore ihre Faszination fürs Biermachen. „Dass man, wenn man sich anstrengt, aus den immer gleichen, einfachen vier Zutaten so gute Biere machen kann, so viel bessere Biere, als die man im Laden kaufen kann, hat mit schon mit 17 restlos fasziniert“, sagt Tobias.
2010 gründen er und Tore To Ol (auf deutsch: Zwei Bier). Ihr früherer Lehrer hilft „mit allem, was im Braubusiness unsexy ist“, erzählt Tobias, also Im- und Exportlizenzen, Steuerkram, Unternehmensgründungsbürokratie. Während dessen studieren beiden Jungs, Tore Informatik und Tobias erst Lebensmittelwissenschaft, dann Brauwesen. Als Tobias letztes Jahr seinen Master macht, hat er einen Tag später einen Fulltime-Job im eigenen Craft Beer Start-Up. „Das war schon etwas ganz besonderes. Weil doch in der Craft Beer Szene viele lange einen anderen Job machen müssen, ehe sie vom Brauen leben können“, sagt er. „Wenn das überhaupt je klappt.“ Als er und Tore sich zweieinhalb Jahre nach Gründung zum ersten mal ein Gehalt auszahlen und er seinen Job als Barkeeper kündigen konnte, sei das schon ein großer Schritt gewesen.
Heute verkauft To Ol Bier in über 30 Ländern und kann eine Liste von – Achtung – an die 100 verschiedenen Bieren vorweisen, die Tobias und Tore als überzeugte Gypsie Brewer im Lauf der vergangenen fünf Jahre erdacht und gebraut haben.

Die zwei kleinen Bier und der buchstabenarme Schriftzug in ganz klein ist das Einzige, was auf allen To Ol Flaschen versteckt irgendwo zu finden ist. (Foto: NAK)
Tobias, wie geht denn das, 100 Biere? Und warum?
Vielleicht weil wir Dänen sind? Ich bin unter anderem deshalb so gern aus Dänemark, weil wir dort keine Brautradition haben. Es gibt keine „dänischen Bierstile“. Von uns erwartet niemand eine bestimmte Bierrichtung, wir sind völlig frei in dem, was wir machen. Und diese Freiheit nutzen wir halt.
Wird denn jedes Bierrezept, das Ihr Euch ausdenkt, nur einmal gebraut?
Nicht ganz. Wir haben zwar kein fixes Standardsortiment, weil mir die Idee nicht gefällt, sich irgendwie biermäßig festzulegen, aber es gibt vier bis fünf Biere, wenn wir die nicht regelmäßig nachbrauen würden, würden die Leute wirklich richtig sauer werden. Also tun wir‘s.
Braucht denn nicht jede Craft Brewery genau so drei, vier „Signature Beers“, die konsistent sind ?
Nein, ich glaube gar nicht an Konsistenz in Sachen Craft Beer. Konsistenz kann und muss es bei unseren Bieren nicht geben. Zum Beispiel: Wenn ich einen neuen Hopfen entdecke, von dem ich denke, dass er in einem unserer bestenden Rezepte noch besser wäre, dann ändere ich das und verwende beim nächsten Sud diesen Hopfen, ohne das groß zu kommunizieren. Das Bier ist dann zwar nicht konsistent, sondern anders als die Charge zuvor – aber es ist besser und darum geht es.

„Jede einzelne Flasche ist ein kleines Kunstwerk“, sagt Tobias Jensen selbst über das Etiketten-Design von To Ol. (Foto: NAK)
Gibt es denn irgendwas, dass die hundert To Øl Biere zusammenhält?
Wir wollen mit unseren Bieren Grenzen ausloten, aber keine Grenzen überschreiten. Anfang des Jahrtausends haben die Leute einfach total extreme Biere gemacht. Super-fett und super-hopfig und super-alkoholisch. Mittlerweile sind wir einen Schritt weiter und versuchen Biere so perfekt wie möglich zu machen. Das heißt: Es ist völlig in Ordnung, ein Session IPA zu machen, das nur 4,5 Vol.% hat, zum Beispiel, aber dafür kann man drei, vier oder fünf davon trinken, ohne von irgendetwas zu viel zu bekommen, zu viel Grapefriut oder zu viel Tannenaroma oder so. Und vielleicht noch ein anderer Ansatz: Wir wollen bestehende Bierstile auf den Prüfstein stellen und sie nach unseren Vorstellungen abwandeln. Zum Beispiel würden wir ein Deutsches Pilsener nehmen, es aber mit amerikanischem Aromahopfen verfeinern oder sogar ein bisschen Orangeschale hineingeben – bis es uns schmeckt.
Wie entscheidet ihr, was Ihr braut?
In erster Linie brauen wir, was wir beide gern trinken würden. Das Gute ist: Die Craft Beer Szene ist ziemlich international, man kommt da schnell in der ganzen Welt herum mit seinen Bieren und die Geschmäcker unterscheiden sich weltweit ziemlich. Wenn wir ein Brown Ale mit Schokolade machen wollen, dann machen wir das. Das wollen sie dann zwar vielleicht nicht in Japan, aber dafür verkaufen wir es gut in Italien oder so.
Oder demnächst auch in Deutschland?
Oder demnächst in Deutschland. Natürlich schauen wir uns derzeit den deutschen Markt genau an. Ehrlich gesagt: Jede Craft Beer Brauerei auf der ganzen Welt tut das, alle warten nur darauf, dass Deutschland als Markt für Craft Beer endlich explodiert. Ich meine: 80 Millionen Menschen, die den zweithöchsten Bierkonsum pro Kopf in Europa haben!? Bis jetzt verkaufen wir mehr Bier in Island als in Deutschland. Island hat 320.000 Einwohner. Ich glaube, Berlin ist schon in Fahrt gekommen. Brew Dog eröffnet demnächst eine Bar hier, da ist Stone, da sind Events wie The Urbanfuel. Aber im Rest von Deutschland muss der Swing erst noch kommen. Da muss man sich nicht-deutschen Bieren und Bierstilen erst einmal öffnen. Ich erinnere mich, wie wir vor ein paar Jahren bei einem Bierfestival in Köln waren. Da sollte das beste Bier der Veranstaltung gewählt werden. Wir waren die einzigen, die ein American-style IPA dabei hatten und ich war total sicher, dass wir damit gewinnen. Wie auch nicht, der Rest hatte nur gewöhnliche deutsche Biere mit, ich hielt das für einen Selbstgänger. Und dann – haben wir nicht gewonnen! (Er lacht herzlich.) Gewonnen hat ein Brauer, der ein Bockbier dabei hatte, das er mit einem deutschen Hopfen, Tettnanger oder Hallertauer, minimal gestopft hatte. Das war einen Hauch hopfiger als normale Biere, aber weiterhin grasig und so, wie deutsche Biere eben sind. Und ganz offenbar war das damals das, was den deutschen Biertrinkern am besten gefiel. Das meine ich eben auch mit dieser Biertradition, die es in Dänemark nicht gibt. In Deutschland gibt es so etwas – und das macht es für Craft Beer nicht unbedingt leichter hier.

Ein Mann und sein Bier: Tobias Emil Jensen vor einem Kühlschrank voll küler To Ols (Foto: NAK)